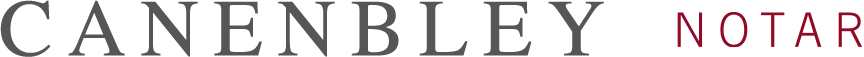von Carsten Canenbley | Sep 24, 2022 | Verkehrsunfallrecht
Mit Dooring-Unfällen werden Zusammenstöße von Radfahrern mit sich plötzlich öffnenden Autotüren umschrieben. Das Landgericht Köln hatte sich mit einem entsprechenden Fall zu befassen und hat entschieden, dass von einer hundertprozentigen Haftung des Autofahrers auszugehen ist, wenn kein Mitverschulden des Radfahrers festgestellt werden kann. Mitverschulden des Radfahrers kann aus ursächlichem Verhalten geschlossen werden, wie z.B. zu geringer Abstand. Eine zu hohe Geschwindigkeit löst nicht ohne Weiteres ein Mitverschulden aus.
LG Köln, Urteil vom 2.8.2022, Az: 5 O 372/20
von Carsten Canenbley | Sep 6, 2022 | Verkehrsrecht, Verkehrsunfallrecht
Auf größeren Parkplatzanlagen stellt sich häufig die Frage, ob die allgemeinen Verkehrsregeln gelten. Hierzu hat sich das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Urteil geäußert. Demzufolge kommt es entscheidend darauf an, ob Fahrbahnmarkierungen oder bauliche Anlagen wie Bordsteine oder Gräben „eindeutig und unmissverständlich“ auf einen Straßencharakter hinweisen und zudem ausreichend Raum für Begegnungsverkehr innerhalb der Fahrspuren vorhanden ist. Nur dann kommt die Heranziehung allgemeiner Verkehrsregeln wie „Rechts-vor-links“ in Betracht.
Auf allen übrigen Parkplätzen gilt ausschließlich das allgemeine Rücksichtnahmegebot. Kreuzen sich zwei Fahrgassen, ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, defensiv zu fahren und die Verständigung mit dem jeweils anderen Fahrzeugführer zu suchen.
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.6.2022, 17 U 21/22
von Carsten Canenbley | Jul 19, 2022 | Verkehrsunfallrecht
Es kommt nicht selten vor, dass ein Unfallbeteiligter im polizeilichen Protokoll angibt, oder – noch häufiger – ankreuzt, den Unfall verschuldet zu haben. Ein solches Schuldanerkenntnis des Fahrers am Unfallort führt nicht etwa dazu, dass der Fahrer für den Unfall haftet, sondern nur zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des Anerkennenden. Es wird also so lange vermutet, dass der Unterzeichner einer solchen Erklärung den Unfall verursacht hat, bis er das Gegenteil bewiesen hat.
OLG Nürnbert, Urteil vom 29.3.2022, Az: 3 U 4188/21
von Carsten Canenbley | Jun 20, 2022 | Verkehrsrecht, Verkehrsunfallrecht
Pedelecs, also Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor, werden von der Rechtssprechung bisher Fahrrädern ohne Motor gleichgestellt. Das bedeutet bei der Beurteilung von Verkehrsunfällen, dass es für die Verschuldensfrage keinen Unterschied macht, ob das Beteiligte Fahrrad mit einem unterstützenden Motor ausgestattet ist oder nicht. Das gilt zumindest für Fahrräder, deren Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt. Es bleibt abzuwarten, ob die Rechtsprechung Verkehrsunfälle und deren Folgen in Zukunft differenzierter danach beurteilen wird, ob ein Fahrrad mit oder ohne Motorunterstützung beteiligt ist.
von Carsten Canenbley | Jun 16, 2022 | Verkehrsunfallrecht
In der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist in § 7 Absatz 5 geregelt, dass ein Fahrstreifenwechsel nur erfolgen darf, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass von einem Verschulden des Fahrstreifenwechslers ausgegangen wird, wenn er nicht das Gegenteil beweisen kann (Anscheinsbeweis).
Der BGH hat in einem jüngst veröffentlichen Urteil entschieden, dass ein „anderer Verkehrsteilnehmer“ im Sinne der Vorschrift nur ein solcher ist, der sich im fließenden Verkehr befindet. Wenn, wie im entschiedenen Fall, sich ein Unfall mit einem vom Fahrbahnrand anfahrenden Verkehrsteilnehmer ereignet, wird nicht von einem Verschulden des Fahrstreifenwechslers ausgegangen.
BGH, Urteil vom 8.3.2022, Az: VI ZR 1308/20
von Carsten Canenbley | Jun 13, 2022 | Verkehrsunfallrecht
Unfälle zwischen Radfahrern und Pkw oder Lkw ereignen sich im Stadtverkehr häufig; meist mit schweren gesundheitlichen Folgen für die Radfahrer. Die Verschuldensfrage richtet sich nach den gültigen Verkehrsregeln, sowie der sogenannten Betriebsgefahr. Bei letzterer handelt es sich um diejenige Gefahr, die das Fahrzeug als solches mit sich bringt und entsprechend ist sie bei z.B. Lkw hoch – bei Fahrrädern niedrig oder mit Null anzusetzen.
In einem vom OLG Hamm entschiedenen Fall wurde die alleinige Schuld an einem Verkehrsunfall dem Radfahrer zugesprochen; die Betriebsgefahr des Pkw wurde auf Null reduziert. Grund für diese Gewichtung war der Umstand, dass der 81-jährige-Radfahrer „blindlings“ die Fahrbahn gequert hatte, also ohne dass für den fließenden und bevorrächtigten Verkehr eine entsprechende Absicht zu erkennen war. Das Gericht wies darauf hin, dass alleine das Alter eines Radfahrers andere Verkehrsteilnehmer nicht zu erhöhter Vorsicht verpflichtet.
OLG Hamm, Hinweisbeschluss vom 8.3.2022, Az: 9 U 157/21